Über die Versuche, das Unerklärliche zu erklären
Wenn mich meine Beobachtung nicht trügt, so suchen viele der spirituell interessierten Menschen unserer Zeit, Naturwissenschaft und Religion auf die eine oder andere Weise miteinander zu verknüpfen, eine Synthese zu finden, eine Art spirituelle Wissenschaft. Woher kommt das? Nun, es ist offensichtlich, dass die Errungenschaften und Erkenntnisse der Naturwissenschaften uns auf Dauer nicht befriedigen. Sie geben keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Daseins. Gerade in unserer modernen westlichen Gesellschaft, die sehr diesseitig ist, materialistisch und oft auch nihilistisch, lässt sich daher ein Bedürfnis oder eine Sehnsucht nach Transzendenz beobachten. Gewiss, die Naturwissenschaften haben uns geholfen, Naturgesetze zu erkennen und damit Naturphänomene zu erklären. Sie haben uns auch Mittel an die Hand gegeben, mit denen wir unsere natürliche Umgebung manipulieren oder beherrschen können. Und diese technischen Möglichkeiten sind durchaus beeindruckend, haben etwas Berauschendes. Aber viele von uns erwachen ernüchtert aus dem Rausch und erkennen, dass ihnen etwas fehlt, und dass die Naturwissenschaften es ihnen nicht geben können.
Gleichwohl können wir die Welt der Naturwissenschaften nicht einfach hinter uns lassen, sobald wir uns religiösen Fragen zuwenden. Denn unsere Erziehung und Bildung haben unser Denken naturwissenschaftlich geprägt. Es wurde trainiert, auf eine bestimmte Weise zu funktionieren. Wir haben die Ideale der Aufklärung, insbesondere den Glauben an die Allmacht der Ratio und Zweckmäßigkeit der Kritik sowie die Ablehnung aller Dogmen und Lehrmeinungen, mehr oder weniger weitgehend verinnerlicht. Aus dieser Einstellung heraus lehnen wir nicht nur jeden religiösen Fanatismus als inakzeptabel, weil widersinnig, ab. Es ist uns auch nicht möglich, etwas zu glauben, was unser Verstand grundsätzlich nicht erklären kann. Es käme uns wie ein Rückfall in prärationale Zeiten vor, ein Verrat an der Vernunft. Wir sehen zwar, dass es in der Welt der Religion unerklärliche Dinge gibt, sind aber überzeugt, sie eines Tages doch erklären zu können. Es scheint uns eine Frage des Fortschritts zu sein und in diesem Fortschrittsglaube lebt die Zuversicht der aufklärerischen Vordenker weiter. Dann, wenn das Unerklärliche schließlich erklärt ist, sind wir bereit, daran zu glauben, genauer gesagt, es als Wirklichkeit zu akzeptieren. Man könnte das, was dabei herauskäme, eine aufgeklärte Religion nennen.

So sehen wir, dass unser Bemühen, Wissenschaft und Religion miteinander zu verbinden, meistens auf den Versuch hinausläuft, uns religiösen Fragen und dem, was wir Gott nennen, mit naturwissenschaftlichen Mitteln und Begriffen zu nähern. Tauchen in einer Heiligen Schrift Zahlen auf, so werden sie etwa als Hinweis auf die Struktur unserer DNA verstanden, also molekularbiologisch interpretiert. Gottesnamen erklären wir uns als energetische Schwingungen, welche auf physikalische Weise in uns wirken, sobald wir sie aussprechen. Demgemäß verstehen wir Wunderheilungen als Demonstration einer göttlichen, also überlegenen Technik, etwa als Folge einer genetischen Umprogrammierung. In den uralten Texten der Überlieferung mutmaßen wir einen Code, eine Art Schlüssel zu höherem Wissen. Religiöse Schriften werden somit zu einer Herausforderung für den Verstand, der die in ihnen vermuteten Rätsel zu lösen hat. Es ist, als ob er sich erst dann zufrieden gibt, wenn er eine Erklärung gefunden hat, die ihn überzeugt, mit der er leben kann.
Tatsächlich ist unser Intellekt auf eine Weise konditioniert, dass er ständig danach trachtet, Probleme zu lösen. Und wo es keine Probleme gibt, konstruiert er selbst welche, damit er etwas zu tun hat. Für ihn ist es ein Leichtes, in überlieferte und bildlich oder gleichnishaft formulierte Texte ein besonderes Wissen hineinzugeheimnissen. Vor allem Zahlen sowie Buchstaben und Silben uralter Sprachen stellen für ihn ein willkommener Stoff zur Konstruktion eines angeblichen Geheimwissens dar. Wir müssen also sehr vorsichtig sein und genau prüfen, ob wir einen wirklichen objektiven Sinn entdeckt oder nur subjektiv, zur Befriedigung unseres Intellekts, einen Zusammenhang konstruiert haben. Und sogar wenn es den Anschein hat, dass sich uns ein objektiver Sinn offenbart hat, gilt es selbstkritisch zu bleiben und zu erforschen, inwieweit sich dieser Sinn im Leben bewährt. Schließlich sollte uns immer bewusst sein, dass hinter jedem von uns erkannten Sinn ein noch größerer steht und, wie es bei Laotse heißt, der Sinn erkennbar nicht ewiger Sinn ist.
Unser naturwissenschaftlich geprägter Verstand kann Gott nur als ein Naturphänomen verstehen, zwar sehr feinstofflich, aber doch stofflich, nicht niedrigschwingend, aber doch als prinzipiell physikalisch messbare Frequenz. Auch Verstandes Neigung, sich die Götter, von denen die alten Überlieferungen erzählen, als Außerirdische zu erklären, passt in dieses Bild. Unser Intellekt ist begrenzt. Er hilft uns zwar, in der erscheinenden Welt zurechtzukommen, ist aber naturgemäß nicht imstande, das Unermessliche und Unerklärliche zu erfassen. Wo er dies dennoch versucht, verliert er die Bodenhaftung, indem er seine in der materiellen Welt gewonnenen Vorstellungen und die daraus konstruierten Konzepte auf eine jenseitige Welt projiziert. Und er scheint jederzeit bereit, sich von seinen eigenen Spekulationen überzeugen zu lassen.
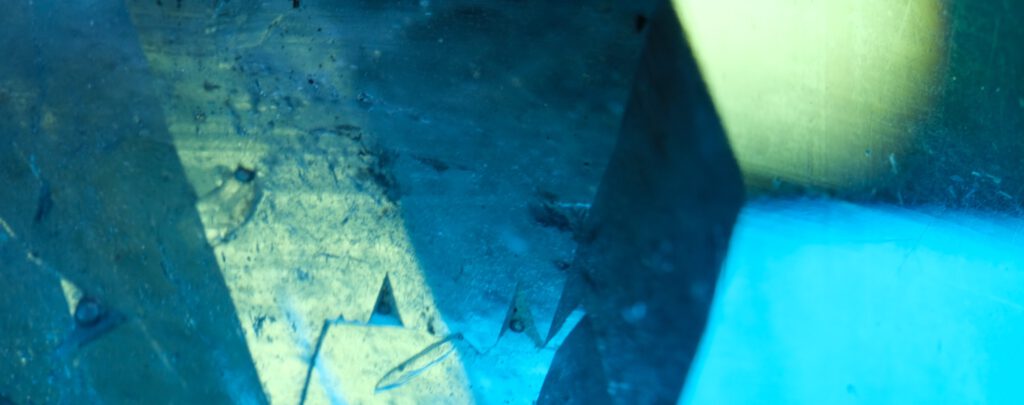
Dieser Verstand ist unbescheiden, berauscht von seiner Fähigkeit für alles eine Erklärung zu generieren. Er macht damit immer weiter und merkt offenbar nicht, wann er seine Kompetenz überschreitet. Dabei zeigt uns doch die Sehnsucht nach Transzendenz, dass in uns eine Ahnung von der Notwendigkeit lebt, den naturwissenschaftlich geprägten Intellekt zurückzulassen, wenn wir uns dem Geist Gottes nähern wollen. Solange unsere Naturwissenschaften weiterhin fast ausschließlich auf Datenverarbeitung durch den Verstand oder gar durch künstliche Intelligenz setzen, können sie der Welt des Geistes unmöglich näherkommen, geschweige denn erkennen. Das gilt auch für die naturwissenschaftlichen Erklärungen religiöser Überlieferungen! Sie mögen faszinierend und reizvoll sein, aber sie machen uns nicht religiös. Vielmehr führen sie zu festen Vorstellungen und Erwartungen, die uns hindern, für das Unermessliche offen zu bleiben.
Der Glaube geht ganz natürlich aus der Erkenntnis hervor, dass unser Intellekt den Geist Gottes niemals erfassen kann. Wer meint, der Glaube sei eine Art vorläufige Annahme, eine Arbeitshypothese, die durch wissenschaftliche Beweise entweder bestätigt oder widerlegt werden kann, hat nicht verstanden, was es heißt, religiös zu sein. Glaube ist ohne Hingabe, ohne die Aufgabe aller Erklärungsversuche, nicht möglich. In uns lebt dann das Wissen um unser Nichtwissen. Das heißt nicht, dass wir im Dasein auf Kritik verzichten. Kritische Selbstforschung ist notwendig, schon alleine, um uns vor jeglichem Aberglauben zu schützen. Aberglaube in seinen vielen Variationen geht immer aus einem zwanghaften Denken hervor. Glaube aber kennt keinen Zwang, denn in ihm ist kein Platz für Furcht. Wer den Glauben hat, begegnet der Welt mit großer Gelassenheit. Und so kann sie ihm Neues offenbaren. Da ahnt er ein Wissen, das er sich nicht denken kann.
Kommentare
[ … Hier kann dein Kommentar veröffentlicht werden.]
